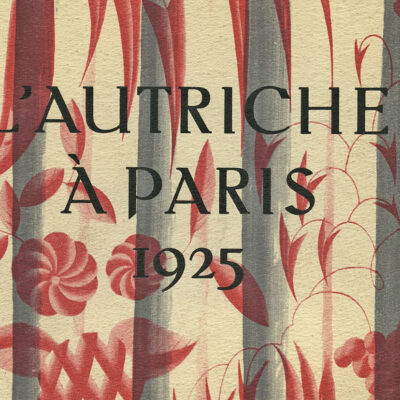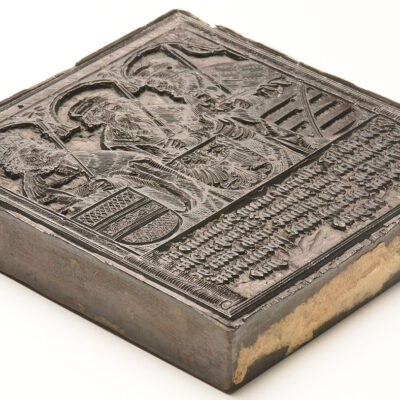Die Sammlung Albert Figdor
Album kuratiert von: Kathrin Pokorny-Nagel, 2025
Albert Figdor (1843–1927) zählte zu Lebzeiten zu den bedeutendsten Kunstsammler*innen Europas. Er investierte sein gesamtes Vermögen in Kunstgegenstände und galt als einer der wichtigsten Förderer von Kunst und Kultur in Wien. Mit Unterstützung des k. k. Österreichischen Museums für Kunst und Industrie (heute MAK), dessen Kuratoriumsmitglied er 1893–1898 war, sowie des dortigen Kustos Alois Riegl sammelte Figdor nicht nur bildende Kunst, sondern hegte auch eine tiefe Leidenschaft für das Kunsthandwerk, künstlerisch gestaltete Alltagsgegenstände und historische Dokumente. Er tat dies rein aus persönlichem Interesse – ohne finanzielle Motive oder musealen Anspruch. Entscheidend war für ihn, dass jedes Sammlungsstück ein „besonderes Etwas“ besaß: Das Zusammenspiel von kulturgeschichtlichem Wert und künstlerischer Gestaltung zog ihn in den Bann. Durch seine enge Verbindung zum Museum schenkte Figdor dem Haus laufend Objekte, die in die Sammlung aufgenommen wurden.
Aus dem Fotoalbum Sammlung Dr. Albert Figdor, Atelier Frankenstein, MAK Inv.nr. KI 10190
MAK/Georg Mayer, CC BY-NC-ND 4.0
Der Großteil der heutigen Sammlung Figdor kam jedoch über Umwege ins MAK: Nach Figdors Tod entbrannte ein mehrjähriger Streit um seinen umfangreichen Nachlass. Während seine Nichte und Erbin, Margarete Becker-Walz, beabsichtigte, die Sammlung vollständig zu veräußern, verfolgte der Staat das Ziel, den wertvollen Bestand zu sichern und in Figdors Wiener Palais öffentlich zu präsentieren. Schließlich musste man dem Wunsch der Erbin nachgeben. Sie übergab alles zum Zweck der öffentlichen Versteigerung an ein Konsortium, dem der Wiener Kunsthändler Gustav Nebehay vorstand. Um das freie Verfügungsrecht über die Hauptmasse zu erhalten, bot Nebehay der Republik Österreich eine Auswahl aus der Sammlung an. Auf diese Weise wurden rund 2.000 Objekte vom Staat Österreich übernommen, als geschlossener Bestand ans Kunsthistorische Museum übergeben und dort bereits 1931 ausgestellt. Gleichzeitig erfolgte eine kursorische Inventarisierung in ein „Vorläufiges kurzes Verzeichnis der Dr. Albert Figdor-Stiftung“.
Im Zuge langwieriger Verhandlungen, die bereits 1929 begannen, aber insbesondere zwischen 1934 und 1936 intensiv geführt wurden, kam es letztlich zu einem Tausch: Die Figdor-Sammlung aus dem Kunsthistorischen Museum – mit Ausnahme der Skulpturen, Gemälde und Viennensia des 19. Jahrhunderts – wurden gegen mittelalterliche Skulpturen aus dem Österreichischen Museum für Kunst und Industrie eingetauscht.